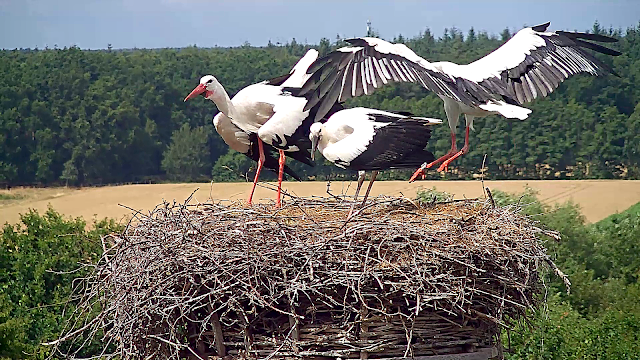Der NLWKN fischt jährlich große Mengen Abfall aus niedersächsischen Flüssen. Zum Aktionstag "World Cleanup Day" weist er auf die Probleme hin, die durch die unerlaubte Entsorgung entstehen.
Fahrräder, Fernseher, Einkaufswagen und jede Menge Plastik – das sind nur einige der Gegenstände, die Mitarbeitende des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) regelmäßig aus niedersächsischen Flüssen und Seen holen. Der Landesbetrieb, zuständig für die Unterhaltung zahlreicher niedersächsischer Binnengewässer, stößt bei der täglichen Arbeit auf große Mengen Müll im, unter und am Wasser. Anlässlich des internationalen Aktionstages "World Cleanup Day" am 16. September 2023, der ein Zeichen gegen die Vermüllung des Planeten setzen soll, weist der NLWKN auf die Folgen eines unerlaubten Wegwerfens und Abladens von Abfällen hin und erklärt, welche Probleme dadurch entstehen.
"Unsere Aufgabe ist es, unsere Landesgewässer in unserem Zuständigkeitsbereich zu unterhalten, um sie als Elemente des Wasserhaushalts und Bestandteile von Natur und Landschaft zu schützen. Durch das unerlaubte Wegwerfen und Abkippen von Müll in die Gewässer wird unsere tägliche Arbeit der Gewässerpflege und -entwicklung aber enorm erschwert. Von ,Entsorgung' im Wortsinn kann hier keine Rede sein, denn Sorgen bereitet solcher Müll noch jede Menge", erklärt Jörn Drosten, Leiter des Geschäftsbereichs Betrieb und Unterhaltung im NLWKN. "Dieser Abfall muss oft mühselig aus dem Wasser entfernt und entsorgt werden. Außerdem beeinträchtigt der Müll die Gewässerqualität und kann großen wie kleinen Tieren erheblichen Schaden zufügen."
 |
| Große Mengen Müll werden gut sichtbar, wenn Wehre oder aber auch Schöpfwerke trockengelegt werden. Bei der Trockenlegung des Wehrs Lüchow wurden unter anderem mehrere Fahrräder geborgen. Foto: NLWKN |
Einer der Flüsse, in dem sich in den vergangenen Jahren regelmäßig Müll angesammelt hat, ist die Jeetzel im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Meistens handelt es sich dabei um weggeworfene Glas- und Plastikflaschen, Dosen, Plastikverpackungen und Küchenabfälle. Diese verfangen sich in den Pflanzen im und am Gewässer sowie in den Anlagen des NLWKN, beispielsweise in der Wehranlage in der Innenstadt von Lüchow. Neben den ökologischen Problemen können Abfälle auch die Funktionsfähigkeit der wasserwirtschaftlichen Anlagen gefährden oder bei Hochwasser an Engstellen den Durchfluss blockieren. Mitarbeitende des NLWKN-Betriebshofs Hitzacker sind deshalb regelmäßig an und auf der Jeetzel unterwegs, um sie sauber zu halten. Müll und sonstiges künstliches Treibgut wird eingesammelt, sortiert und fachgerecht entsorgt. Insbesondere im Sommer während der erforderlichen Krautung fahren Mitarbeitende das Gewässer systematisch ab, um die Pflanzen, die gemäht oder entfernt werden müssen, vom Unrat zu befreien, der sonst ins Schnittgut geraten würde.
Aber auch größere Gegenstände wie Fahrräder oder Einkaufswagen werden zum Teil an Anlagen des NLWKN abgestellt oder – insbesondere in der Nähe von Brücken – ins Wasser geworfen. "Die genaue Menge variiert, aber da kommen jährlich mehrere Kubikmeter Müll zusammen", berichtet Klaus Jänsch von der für die Unterhaltung der Jeetzel zuständigen NLWKN-Betriebsstelle Lüneburg.
Ein grundsätzliches Problem ist nicht nur die Menge, sondern auch die "Verpackung". "Oftmals bergen wir große Säcke aus den Gewässern, bei denen auf den ersten Blick nicht erkennbar ist, was da eigentlich drin ist. Nicht genau zu wissen, womit man es zu tun hat, löst bei den Kollegen Unwohlsein aus", erklärt Klaus Jänsch. Leider komme es auch regelmäßig vor, dass Windel- und Müllsäcke gezielt am Gewässer abgelegt oder sogar ins Wasser geworfen werden.
Große Mengen Müll werden auch immer dann sichtbar, wenn Wehre oder Schöpfwerke trockengelegt werden. So tauchen dann häufig Fahrräder und andere große Gegenstände auf. Aber auch Diebesgut oder aufgebrochene Zigarettenautomaten konnte der NLWKN auf diese Weise wieder ans Tageslicht holen. "Wir haben aber auch schon einmal einen Berg Matratzen neben einem Auslassbauwerk gefunden", sagt Jänsch.
Auf Entdeckungen dieser Art möchte der NLWKN künftig am liebsten komplett verzichten. "Durch unsere Arbeit wollen wir der Vermüllung entgegenwirken und die Gewässer sauber halten. Aber wir sind dabei auch auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Niemand darf Müll im oder am Gewässer hinterlassen und schon gar nicht gezielt dort entsorgen", betont Drosten.
Ein weiteres Problem kann dann entstehen, wenn Privatpersonen mit Metalldetektoren und Magnetangeln den Gewässergrund absuchen. Der NLWKN weist darauf hin, dass der Einsatz dieser Geräte verboten ist, wenn keine Genehmigung vorliegt. Dies dient vor allem den Schutz der "Schatzsucher", denn auch explosive Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg werden bei Traglasten der eingesetzten "Angeln" von bis zu 1000 Kilogramm regelmäßig angezogen. Telekommunikations- und Versorgungsleitungen im Gewässergrund können durch das Magnetangeln ebenfalls beschädigt werden. "Die Absicht, auf diese Weise etwas gegen die Vermüllung der Gewässer unternehmen zu wollen, ist ehrenwert, in der konkreten Art und Weise aber leider mit echten Gefahren verbunden", erklärt der NLWKN.